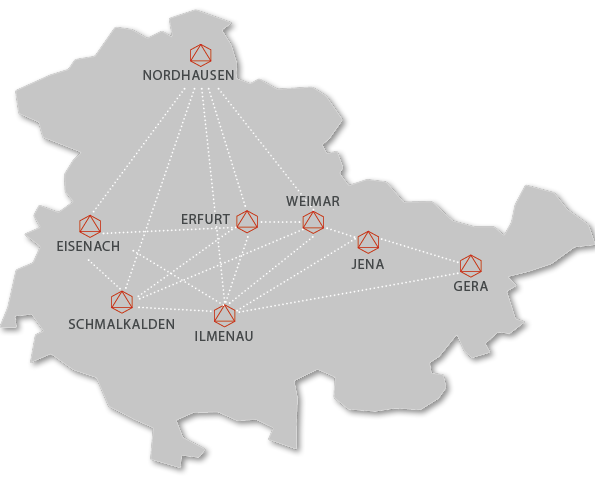Dr. Jutta Panieske-Pasterkamp, Hochschule Nordhausen
Erneuerbare Energien sind spätestens seit Fukushima auch bei den meisten politischen Hardlinern aus der Nische vorgerückt. Die Energien der Zukunft werden verstärkt regional, ja sogar lokal erzeugt. Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp beschäftigt sich als Geographin mit unserem Planeten in seiner räumlichen Struktur und Entwicklung und vor allem mit seiner Beschaffenheit als Lebensraum auch für uns Menschen.
Die gebürtige Saarländerin Jutta Parnieske-Pasterkamp hat es 1995 nach Thüringen verschlagen, um ihre Diplomarbeit über die Aschehalden in Nordthüringen zu schreiben. In der K-UTEC GmbH Sondershausen war sie ab 1996 in der Abteilung Abfall/Altlasten beschäftigt, wo sie in einem Forschungsprojekt die Umweltauswirkungen und die Alterung der Salzhalden im ehemaligen Kalirevier im Südharz untersuchte. Seit dem Sommersemester 2001 unterrichtet Sie an der Hochschule Nordhausen naturwissenschaftliche Grundlagen und engagiert sich für mehr Frauen in MINT-Berufen.
Ihr Fach sind quasi die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Welchen Beitrag können diese denn konkret als Energiequelle leisten, welche Potentiale stecken hierin?
Sie sind der Beitrag – der Raum stellt uns mit ganz unterschiedlichen Potentialen viel mehr Energie zur Verfügung, wie wir jemals nutzen können. Die Frage ist nur: Wie kann ich sie möglichst effektiv und nachhaltig, also ohne großen Eingriff in die Natur und ressourcenschonend, umwandeln und vereinfacht gesagt Strom für die Steckdose oder Treibstoff für die Autos produzieren. Und wie kann ich nicht benötigte Energie speichern, um auch bei Windstille Kuchen im Backofen zu backen? Das ist ein wichtiger Knackpunkt. Zum Raum gehört natürlich auch noch die Biomasse, die bei effektiver und nachhaltiger Flächennutzung auch ohne Mais-Monokulturen auskommt. Und sie liefert flüssige Energie, die wir als Treibstoff in den Fahrzeugen nutzen können.
Sie sind Geographin, da ziehe ich vielleicht vorschnell den Schluss, dass Sie auch eine Verfechterin von Erneuerbaren Energien sind!? Kann man Ihre Tätigkeit am „Energie-Campus“ in Thüringen als zusätzliches Zeugnis dieser Spekulation ansehen?
Genau. Von Beginn an habe ich den Studiengang Regenerative Energietechnik mit meinen Lehrveranstaltungen zu naturwissenschaftlichen Grundlagen unterstützen dürfen – die Technik zu kennen ist das eine, aber die Grundlagen der Natur zu verstehen ist aus meiner Sicht für einen angehenden Ingenieur fast noch wichtiger.
Mit den Grundlagen der Natur hat sich auch der Philosoph Immanuel Kant beschäftigt. Der sagte: „Es ist nichts, was den geschulten Verstand mehr kultiviert und bildet, als Geographie.“ Was ist denn für Sie so spannend an der Geographie?
Spannend sind die Komplexität und das Vielfältige – man muss gewillt sein, sehr komplexe Zusammenhänge, die sich innerhalb von wenigen Sekunden oder eben Jahrmillionen verändern, verstehen zu wollen. Der Blick fürs Ganze, der ist, so glaube ich, sehr wichtig. Und die Phantasie – ich kann mir eben nur ausmalen, wie eine Gesteinsart oder ein Bodentyp entstanden sind, beobachten lässt sich dies kaum. Nur mit dem Wetter ist das anders. Das ist dynamisch und launisch – und im Prinzip kaum vorhersagbar.
Ihre Leidenschaft für die Geographie, wo und wann ist die eigentlich geboren? Zählten Sie zu den Kindern, deren Temperament nur draußen an der frischen Luft in den Felder und Fluren zu bändigen war?
Eigentlich nicht, ich war gerne draußen, ja – aber zunächst wollte ich eigentlich mal BWL studieren, habe ich auch ein paar Semester lang durchgehalten. Auf Geographie hat mich dann ein Freund gebracht, der immer begeistert von seinen Geländepraktika und Exkursionen erzählt hat. Das klang gut und war dann ja auch wirklich das richtige für mich.
Und wie haben Sie zur Technik gefunden? Das liegt ja letztlich für eine Geographin gar nicht so nahe! Hatten Sie hier ein Schlüsselerlebnis oder beschäftigt man sich im Geographie-Studium auch mit Maschinen, die gewisse Funktionsweisen in der Natur verdeutlichen helfen?
Meine Kollegen in der KUTEC waren allesamt Verfahrenstechniker und haben mir so ihre Sichtweise vermittelt. Technik spielte in meiner Ausbildung bei der Probeentnahme im Feld und im Labor eine Rolle. Mein Schlüsselerlebnis waren eher meine Lehrveranstaltungen an der FH, die sich im Laufe der Jahre an die ingenieurwissenschaftliche Ausbildung angepasst haben. Die Studierenden fragen nach, warum muss ich als Ingenieur was von Wetter oder Steinen oder Boden verstehen. Also entwickelt man sich, schaut über den eigenen Tellerrand hinaus und stellt die wichtigen Zusammenhänge her.
An der Fachhochschule Nordhausen vermitteln Sie als Dozentin in Vorträgen, Vorlesungen und Seminaren die Grundlagen der Geowissenschaften, Sie unterrichten über Geothermie, Meteorologie und nachwachsende Rohstoffe. Was ist Ihnen in der Lehre denn besonders wertvoll zu vermitteln? Was soll bei Ihren Studierenden hängen bleiben?
Die Studierenden sollen in meinen Veranstaltungen lernen, die Ressourcen, die sie „kostenfrei“ von der Natur zur Verfügung gestellt bekommen, zu verstehen und wertzuschätzen. Nur wenn ich diese Grundlagen, also Sonne, Wind und Wärme verstehe, kann ich mir Gedanken über Standortplanungen und effektive und nachhaltige Energieerzeugung machen.
Die Vermittlung von Wissen ist sicher ein wichtiger Punkt in der Hochschullehre. Die Hochschulen erkennen aber immer mehr, dass das Studium zu einem recht großen Teil zur Persönlichkeitsbildung beiträgt. Die Beziehung von Dozent/innen und Studierenden spielen hierbei sicher eine herausragende Rolle. Wie verstehen Sie denn Ihre Beziehung zu Ihren Studierenden? Wie füllen Sie das aus?
Meine Beziehung zu den Studierenden – nun ja, ich habe immer eine offene Tür und scheue mich auch nicht in der Mensa das Gespräch zu potentiellen Bachelor-Arbeiten oder Praktika mit den Studierenden in der Warteschlange zu führen. Meine Studierenden sind die Chefs von morgen, mir ist es daher sehr wichtig, Ihnen zu vermitteln, wie wichtig offene und ehrliche Kommunikation ist – und wie einfach.
An Ihrer Arbeitsstätte sind Sie ja auch unmittelbar mit dem Thema Technik konfrontiert. Wie ist denn Ihr Eindruck: Ist das Berufs- und Studienfeld Technik denn wirklich eher was für die Jungs? Sie haben ja einmal in einem Vortrag mit dem Titel „Patente Frauen – was haben Scheibenwischeranlagen und Geschirrspülmaschinen gemeinsam?“ das Gegenteil zu beweisen versucht! Was sind Ihre Argumente?
Die patenten Frauen – für mich war es richtig spannend, dazu zu recherchieren und es gab einige Aha-Effekte, was Frauen so alles erfunden haben, so z.B. die Streichhölzer oder den Scheibenwischer. Der Hintergrund solcher Erfindungen war doch immer: Das muss anders, besser gehen. Neugierde und Forscherdrang, ich glaube der ist geschlechtsneutral.
Zurück zu Ihrer Frage: Ich glaube nicht, dass es um „Technik ist eher was für Jungs“ geht, ich glaube eher, dass alleine der Antrieb, Technik zu erlernen, den Mädchen und Frauen seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts verloren gegangen ist und auch in der Schule immer weniger gefördert wird. Das ist schade, Technik als Schulfach wäre aus meiner Sicht eine gute Idee.
Wie ist Ihre Erfahrung dann mit den jungen Frauen, die sich trotz dieser negativen Entwicklung für ein technisches Studium entschieden haben?
Unsere Mädchen in den technischen Studiengängen, es sind zwar nur 3 von 10, aber die sind höchst motiviert – und vor allem und gerade dann, wenn sie schon Familie und Nachwuchs haben. Gemeinsam mit unserer Familien- und Gleichstellungsbeauftragten haben wir uns in Nordhausen aber viel einfallen lassen, um vor allem die Mädels während der Studienzeit zu unterstützen. Und das wichtigste aus meiner Sicht ist eben immer – das offene Ohr für alle und alles.
Wir reden hier über Erneuerbare Energien und Hochschullehre, Ihre fachliche Heimat sind aber Umwelt und Recycling? In Ihrer Doktorarbeit konnten Sie errechnen, dass die Salzhalden im Südharz noch 1000 Jahre oder länger eine Umwelt-Belastung darstellen können. Wie kommt man zu so einem Ergebnis?
Genau, die Kalihalden, wären die nicht gewesen, hätte ich sicher einen anderen beruflichen Weg in einer anderen Region Deutschlands eingeschlagen. Diese roten, über 100 m hohen Halden mit schneeweißen Salzkristallen im Sommer und einem herrlichen Ausblick über den Südharz – die hatten es mir richtig angetan. Ich konnte damals in einem großen Forschungsprojekt zur Rekultivierung der Halden mitarbeiten. In einem nachfolgenden Projekt wurden dann Halden durchbohrt, um einen Blick ins Innere und „unter“ die Halden zu werfen. Die Ergebnisse dieser Bohrungen, die Sickerwässer aus den Halden und deren chemische Zusammensetzung haben es dann ermöglicht, die Zeit abzuschätzen, die ein Regentropfen braucht, um von der Haldenoberfläche bis ins Grundwasser zu gelangen. Natürliche radioaktive Isotope wie Tritium haben dabei eine wichtige Rolle als Marker im Niederschlag gespielt. Nun: Das Haldenvolumen war bekannt, die Salzmenge, die vom Regenwasser gelöst werden kann, war bekannt, die Dauer der Versickerung durch den Haldenkörper war bekannt. Alles zusammen, dreidimensional gedacht, ergab das Ergebnis, dass eben in 1000 Jahren nur noch ein kleiner unlöslicher Rest der Halde übrig geblieben wäre. Aber: Das Grundwasser wäre dauerhaft versalzen und damit nicht mehr als Trinkwasser nutzbar. Die Haldenrekultivierung ist der einzige Weg, dies zu verhindern
Dieses Forschungsthema haben Sie 2004 abgeschlossen. Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich denn jetzt an der FH, fachlich gesehen – neben der Lehre?
Meine Aufgabe ist es, Schülerinnen in den Schulen davon zu überzeugen, wie spannend Technik sein kann. Dazu gehen wir innovative Wege, in dem wir gezielt die Grundschulen ansprechen. In einem Pilotprojekt wollen wir eine Handreichung entwickeln, die dann auch von anderen weitergenutzt werden kann. Unsere Idee ist die Bildungswende gekoppelt mit der Energiewende, die wir im Rahmen der Schulprogrammarbeit umsetzen wollen. Ziel ist es, den kleinen Forschern von übermorgen klar zu machen, wie wichtig Mathe, Physik und Bio in der weiterführenden Schule wirklich sind. Dazu werden von uns erst mal die Grundschullehrer im Bereich Erneuerbare Energien geschult.
Außerdem bin ich Koordinatorin für den Weiterbildungsstudiengang Umwelttechnik und Recycling, der von der Otto Benecke Stiftung e.V. aus Bonn getragen wird. Derzeit lernen 19 ausgebildete Akademiker aus 10 Nationen bei uns neueste Umwelttechnik kennen. Mit mindestens 30 Semesterwochenstunden ist die Weiterbildung auf Hochschulniveau eine echte Herausforderung für unsere Studenten, die zwischen 27 und 50 Jahre alt sind.
In Ihrer Freizeit sind Sie häufiger in regenfester Kleidung und in Gummistiefeln anzutreffen, Sie zählen Sonnenstunden und messen Temperaturen und werden manchmal von der Presse aufgelauert und als „Wetterfrosch“ befragt. Scheinbar sind Sie Geographin 24 Stunden am Tag! Gewähren Sie mir doch bitte einen kleinen Blick in Ihr Privatleben?
Ich glaube, da haben sie Recht. Aber es sind eher Wanderschuhe. Mein Privatleben: Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, der kleine wird im Sommer eingeschult, ich beackere sooft es geht meinen Garten oder gehe mit unseren Hunden spazieren. Vor drei Jahren habe ich eine Stiftung ins Leben gerufen, die gemeinnützige Arbeit in meinem Wohnort leistet, und unser Stiftungsvermögen sind 90 ha Wald und Wiesen, da gibt es viel zu tun.
Wie es aussieht habe Sie im Norden Thüringens eine zweite Heimat gefunden! Das könnte man sicher auch noch sehr vertiefen, aber abschließend will ich noch für eine letzte Frage auf das Technik-Studium zu sprechen kommen: Wen macht ein Studium der Erneuerbaren Energietechnik bzw. der Umwelt- und Recycling-Technik glücklich?
Es macht vor allem die glücklich, die während der Schulzeit Wert auf ihre naturwissenschaftliche Ausbildung gelegt haben. Die haben nämlich in den ersten Semestern sicher weniger schlaflose Lern-Nächte und Mathe-Crash-Kurse sind so gut vermeidbar. Der Gedanke, etwas positives für die Umwelt zu tun und unseren Energiehunger nachhaltig zu stillen sind aus meiner Sicht zwar wichtig, die Ernüchterung kommt aber spätestens nach zwei Wochen Studium, wenn klar wird, dass die Ausbildung zunächst sehr theorielastig und wenig mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu tun hat. Wer den ersten Studienabschnitt dann hinter sich gebracht hat, wird mit Seminaren und anwendungsbezogenen Themen belohnt und kann sich in Sachen Umweltschutz und nachhaltige Energieversorgung so richtig austoben.
Herzlichen Dank für das anregende Gespräch. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit an der Hochschule und bei Ihren Projekten weiterhin viel Erfolg.